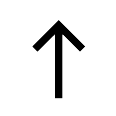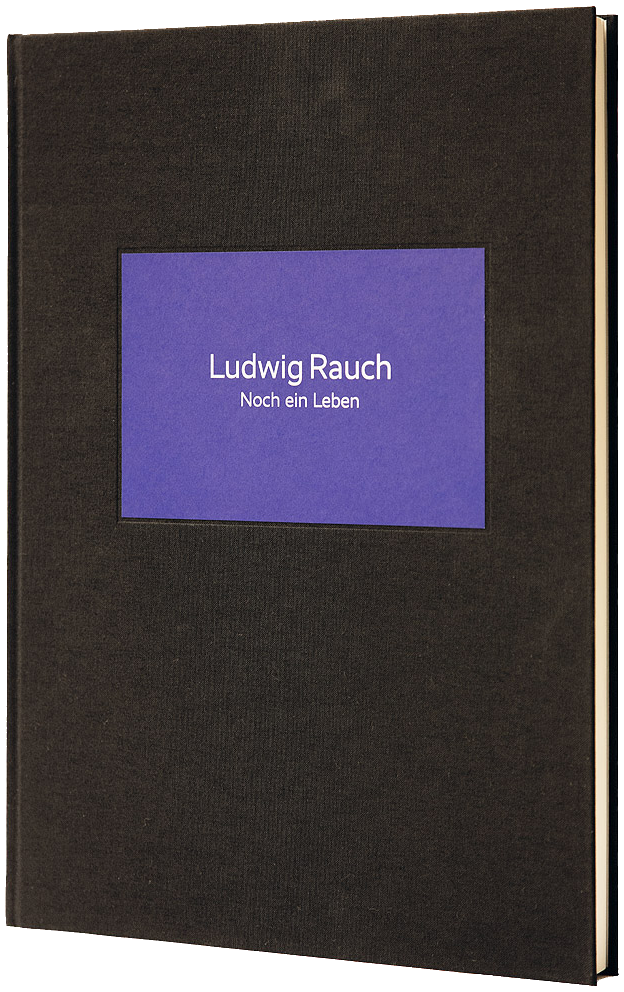
Noch ein Leben
Werksübersichtseit 1992
Mehr...seit 1992
Mehr...
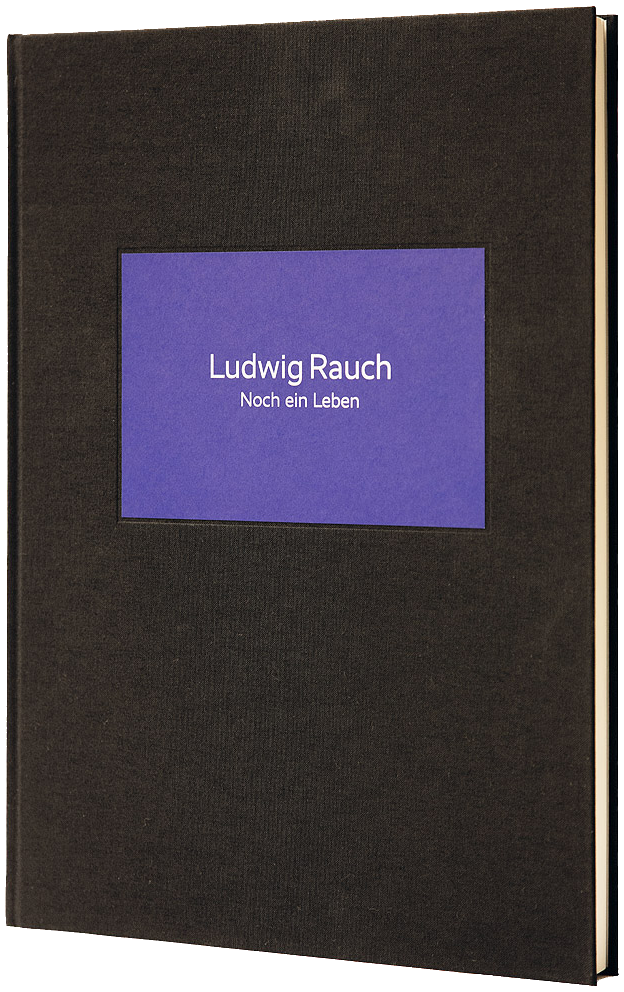
Die Unabweisbarkeit des Bildes
Der Fotograf Ludwig Rauch
Die Hermetik der Geschichte ergibt sich aus der Faulheit der Gegenwart. Was wir wissen, schreiben wir von den Vorgängern ab. Wenn Boris von Brauchitsch in seiner „Kleinen Geschichte der Fotografie“ also erklärt, dass angesichts „der Millionen von herausragenden Aufnahmen“, die seit Entstehung der Fotografie produziert wurden, am meisten das Bedürfnis der Kenner überrasche, „die immer gleichen Künstler mit den immer gleichen Werken zu präsentieren“, dann hatte er gute Gründe, seine Auswahl „radikal und subjektiv“ zu treffen.(1) Ich arbeite in diesem Sinne mit, indem ich auf die Fotografien von Ludwig Rauch verweise. Seine Bilder haben mich ein halbes Leben lang begleitet, ganz gleich, ob ich als Kritiker, Redakteur oder Publizist unterwegs gewesen bin. Und jetzt, wo das Werk zu musealen Ehren kommt, bedarf es nicht einmal mehr der müden Kollegen, um den Sinn dieses Textes zu erörtern.
Das Foto von der „Brigade Karl Marx, VEB Elektrokohle Berlin“ (S....) ist eine klassische Auftragsarbeit für ein klassisches Gruppenporträt. Es entstand für die Neue Berliner Illustrierte (NBI), eine auflagenstarke Wochenzeitschrift in der DDR. Sinn des Auftrags war, der herrschenden Klasse ein Gesicht von repräsentativer Gültigkeit zu geben und dieses Überbild durch die Authentizität einer Fotografie zu beglaubigen. Ludwig Rauch trieb sich ein halbes Jahr in der Produktion herum, bis er die Arbeiter kannte und ein Ergebnis vorlag, das ihn zufriedenstellte. Die Veröffentlichung dieses Fotos wurde verboten. Der Fotograf gleich mit. Ihn ereilte ein Publikationsverbot, bei dem es blieb, bis er ausgereist war.
Die Gründe für die Zurückweisung sind nur scheinbar offensichtlich. Natürlich sehen Sieger der Geschichte so nicht aus. Das liegt aber nicht daran, dass Rauch die Arbeiter auch anders hätte fotografieren können. Das Problem ist vielmehr, dass es Sieger der Geschichte nicht gibt, aber ein Bild von ihnen. Zum Vorbild, das in der Öffentlichkeit wirken sollte, gab es ein Vor-Bild, das im Kopf des Auftraggebers steckte. Die Klischees sind immer schon da, lange bevor jemand losgeschickt wird, sie zu bestätigen. Jeder Künstler, der solche Vorgaben bedienen will, muss also scheitern, und zwar weniger an seinem Geschick als an seiner Entbehrlichkeit. Diese tendenzielle Selbstaufhebung aber kam für Ludwig Rauch nicht infrage, weil er der Überzeugung war (und ist), dass die Würdeform des Bildes von der Würde seines Gegenstands konstituiert wird.
2.
Anders als der Auftraggeber hatten die Arbeiter kein Bild von sich. Für sie konnte das schmutzige Kleid ihrer Verrichtungen keine Aussagekraft haben, da sie sich in dieser Gestalt nicht mehr wahrnahmen. Genau diese posenfreie und absichtslose Selbstgewissheit offenbart das Bild. Die stärkste Wirkung dieses Bildes demnach ist, dass es sich zutiefst bejaht: Porträtierte und Porträtist signalisieren eine übergreifende Akzeptanz und erreichen im Bildsinn das, was man auch Harmonie nennen könnte, denn nichts in dem Foto will über sich hinaus. Zu sehen ist eine dunkle und eine helle Gruppe von je vier Arbeitern. Der Chef steht rechts als Neunter beiseite und schließt das Halbrund einer durchkomponierten Staffage. Das Porträt gelingt, weil das Bild gelingt: In der Ordnung der Positionen zeigt sich die Hierarchie der Arbeit, in den Requisiten der Arbeit das Gleichmachende des Schuftens. Der Lichtraum öffnet sich in die Tiefe detailzergliederter Maschinentechnik. Sie scheint wie das Personal einem versunkenen Zeitalter zu entstammen. Trotzdem ist nicht die Museumskulisse der Ausbeutung interessant, nicht das gegenständliche Flair der Geschichte, sondern die bedürftige Gegenwart, in der sie konserviert ist. Vor Augen steht das epochal zurückgeschlagene Überlebensmilieu jener fortwährenden Nachkriegsgesellschaft, als die man die DDR begreifen muss. Das Leben in diesen Verhältnissen als ein unbeanstandetes Dasein zu zeigen, war ein subtiles Ziel, das keines dissidentischen Ehrgeizes bedurfte. Und so war das Problem für den Auftraggeber nicht irgendeine Botschaft, sondern die Unabweisbarkeit des Bildes.
3.
Auf dieses frühe Werk musste so ausführlich eingegangen werden, weil es Auskunft gibt über ein grundsätzliches Bilddenken, das auch spätere Produktionslinien des Fotografen bestimmen wird. Porträt, Dokumentation und Reportage bleiben die klassischen Domänen seiner Arbeit. Daneben entstehen Materialexperimente, Bildkompilationen, Makrostudien und offene Serien. Ganz gleich aber, ob Ludwig Rauch als Fotojournalist unterwegs ist oder an freien Projekten arbeitet – die Präzision der Anlage aller aussagenden Bildkomponenten bleibt ebenso entscheidend wie die vorurteilsfreie, sozusagen weiße Zuwendung an das, was im Hell-Dunkel der Grauwerte oder in den Farbstufen und Kontrasten einer Stimmung sichtbar werden soll. Ein gelungenes Bild kann für ihn nur sein, was gegenüber dem Sichtbaren in einem umfassenden Sinn „zutrifft“. Ein Motiv wird erwählt, nicht gefunden. Sein Gefühlswert beruht auf seiner Einmaligkeit. Der Gefühlswert des Bildes aber teilt sich in den Zeichen seines Gewordenseins mit. Das Wort „Auslösen“ steht bei Rauch immer für den Doppelsinn, auch etwas auslösen zu wollen. Darum liegt es ihm fern, auf Bildern die Zeit einzufrieren und sie in den abstrakten Strukturen formgebundener Rhythmen oder unter konzeptbestimmten Voraussetzungen zu enträumlichen. Die Dinge auf seinen Bildern sprechen immer von einem Herkommen und tragen so immer auch ihre und die Geschichte des Fotografen mit.
4.
Diese Prägung ist ihm spätestens mit seiner Ausreise nach West-Berlin klar geworden. Was Ludwig Rauch Anfang 1989 als noch nicht Dreißigjähriger hinter sich lassen musste, zwang ihn erstmals, nach den Konstanten seiner Konzeption zu suchen, um in einer fremden Welt fremder Bilder überhaupt zurechtzukommen. Und das geschah nochmals, als nach einigen Monaten der Osten zusammenbrach und sich anschickte, ihn wieder einzuholen. Dieses doppelte Scharfstellen an einer Zäsur seiner Biografie hat ihm, anders als vielen seiner Kollegen, innere Sicherheit verschafft. Sie befreite ihn von den Zwängen ungewollter Notgemeinschaften. Rauch war für den Verlust der Bindungen bestens gerüstet, da er ebenso gut als Bild-Journalist zu arbeiten gelernt hatte wie als Vertreter einer künstlerischen Fotografie. Nach seinem Selbstverständnis gab es zwischen beidem, wie man an dem Brigadebild sehen kann, ohnehin keinen legitimierungsbedürftigen Unterschied.
Er arbeitete in den 1990er Jahren für „Tempo“, „stern“ und „Zeitmagazin“. 1991 war er Mitbegründer der Zeitschrift „neue bildende Kunst“, die bis Ende 1999 existierte und als von Kunsthistorikern geleitetes Kritikerjournal das internationale Kunstgeschehen reflektierte. Für die neun Jahrgänge verantwortete Rauch die Bildredaktion und schuf ein riesiges Material zum Milieu des Kunstbetriebes, das er bis auf den heutigen Tag ausbaut. Die Themen reichen von Werkaufnahmen über Künstlerporträts bis zu Szenenbildern von Kunstmessen und Ausstellungsinszenierungen. Neben Studien zum Publikum finden sich Stilleben der Erschöpfung, die an den Randzonen der hektischen Geldzirkulation zurückgeblieben war. Es entstand das Panoptikum einer eigenen, hermetischen Lebenssphäre, die für einen Fotografen alles bereithielt, was von der „Menschlichen Komödie“ zu erwarten war und außerdem alles versuchte, um als Kunstwelt selbst zur Kunst zu werden.
Vor allem Museen, ganz gleich, ob es sich um kunst- oder naturhistorische Sammlungen handelte, erweckten sein Interesse. Wo immer er sich auf seinen Reisen befand, er suchte sie als die geheimnisvollen Orte einer unstillbaren Sehnsucht auf, die sie überall sind. Das Bedürfnis der Menschen nach Schönheit, Wissen und Einmaligkeit, ihre Gier nach dem Anblick des Unvergänglichen und dem fraglos Bedeutsamen interessierte ihn nicht weniger als die Inszenierungen der Bewahrung. Denn die aufwendigen Darreichungsformen des Erinnerns mit ihren Seidentapeten, Marmorsockeln und Kristallvitrinen dienen dazu, eine Ewigkeit ansichtig zu machen, die sich in Fotografien wieder momentanisiert. Das Foto, ein Bild vom Bild, verewigt nicht die Werke, sondern die Unzulänglichkeit des Besucherblicks, dem auch das Objektiv auf seine spezielle Art folgt. Die Frage, die Ludwig Rauch an der Konstellation beschäftigt, ist, was die eigene Kunst dann mit der vorgefundenen verbindet.
5.
Mit dem riesigen, facettenreichen Material jahrelangen Arbeitens, das sich auf den unterschiedlichsten Gebieten angesammelt hatte, entfaltete sich ein Gesamtwerk, das den Fotografen bestens geeignet machte, sein Wissen, aber auch seine Zweifel weiterzugeben. So arbeitet Ludwig Rauch heute als Dozent an der Ostkreuzschule für Fotografie. Er setzt damit eine Arbeit fort, in der ihm zuletzt sein Lehrer Arno Fischer (1927 – 2011) vorausgegangen war. So schloss sich ein Kreis. Fischer und Evelyn Richter (geb. 1930) hatten in den 1980er Jahren für eine ganze Fotografengeneration Maßstäbe gesetzt und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst eine Position aufgebaut, die heute als andere Leipziger Schule gilt. Zu diesem bedeutsamen Umfeld gehört auch Sibylle Bergemann (1941 – 2010), die 1990 wiederum die Ostkreuz-Agentur mitbegründet hatte.
Mit diesen Namen ist eine Epoche verbunden, in der sich die Ostdeutschen Fotografie konstituiert und einen unanfechtbaren Beitrag zur europäischen Fotokunst geleistet hat. Ludwig Rauch, soweit ihn seine eigenen Wege auch geführt haben, bekennt sich zu dieser Herkunft. Und es wäre einfacher, das zu sagen, wenn die Debatten über Sinn, Funktion und Bedeutung der DDR-Kunst wegen ihrer Langweiligkeit endlich verstummen würden. Die Irrelevanz heute gefällter Urteile ergibt sich aus der Irrelevanz ihrer heutigen Gründe: Der ahistorische Gebrauch ideologisch fundierter Freiheits- und Autonomiebegriffe führt auch hier zu einem System der immer gleichen Namen und Werke, ohne dass die herangezogenen Beispiele auf ihre internen Zusammenhänge, auf ihre Ursachen und Wirkungsabsichten hin untersucht worden wären. Die Horizontlinie ist viel zu flach gezogen, weil die kunsthistorische Referenz, auf die sich auch die Fotografie in der DDR bezog, ausgeblendet bleibt. So korrespondierten die Positionen in Leipzig ja auch mit der Weltkunst, etwa mit den Werken von Gyula Halász (Brassai), Henri Cartier-Bresson oder Josef Koudelka. Diese Art des Fotografierens konstatierte und dokumentierte nicht mehr im Sinne des Neuen Sehens und der Sachlichkeit, wie sie in der deutschen Tradition verankert waren. Sie ermutigte vielmehr zu einer subjektivierten Fotografie, die als Reflex auf die erstarrte Bildlichkeit der Gesellschaft die einzig glaubwürdige Antwort zu geben schien. Ebenso stark wirkte die amerikanische Reportage- und Dokumentarfotografie aus den 1950er und 1960er Jahren weiter. Diane Arbus und Robert Frank, vor allem seine Serie „The Americans“ von 1955, aber auch Lee Friedlander, Stephen Shore und William Eggleston hatten in hochemotionalen Fotografien den „amerikanischen Traum“ beerdigt. Auch diese Welt hielt ihre Versprechungen nicht. Das Defizitäre an den Verheißungen des Westens, das Fotografen plötzlich sichtbar machten, konnte vielmehr als Parallele für die Ernüchterungen im Osten verstanden werden. Ein Foto wie das Brigadebild von Ludwig Rauch war nur in Berlin möglich, aber es befand sich in einer Reihe mit der sozialdokumentarischen Porträtfotografie, wie sie auch am anderen Pol der Welt entstand.
In diesem Sinne haben Fotografen wie Ludwig Rauch aus der DDR nicht nur bleibende Dokumente von einem inzwischen verschollenen Leben hinterlegt, sondern wesentlich radikaler als die Maler ein Bild jener Gesellschaftsordnung offenbart, die über 40 Jahre einen riesigen Teil der Welt dominiert hat. Die Fotografien aus diesem geistigen Umfeld zeigen eine im Verfall ausharrende Daseinsform, deren konkrete Alltagsverrichtungen darauf eingestimmt waren, Techniken des Durchkommens einzuüben und deren Glücksanspruch nicht darin aufging, sich im Unabänderlichen einzurichten. So begegnet man in Rauchs Fotografien überall den ergreifenden Zeichen einer unzerstörbaren Menschlichkeit, die sich nirgendwo deutlicher artikuliert, als in den Konglomeraten ihrer generationsübergreifenden Selbstbehauptung: Stuhl, Bett, Schrank, Kamm, Hinterhof, Ladengeschäft und Straßenleben.
6.
Ludwig Rauch konnte diesen existenziellen Ansatz zur Weltbegegnung weitertragen, ganz gleich, ob er in Berlin, New York, Venedig, Paris, Madrid, Istanbul oder in Havanna unterwegs war. Der Blick über Moskau ist der Blick auf die Vitalität einer urbanen Selbstzerstörung von unfassbaren Ausmaßen und doch nicht nur der Abgesang auf ein Weltreich, dessen Symbol, der Stern, diese Gegenwart immer noch überragt (S....). Dieses vielgestaltige, wenn man so will: geräuschvolle Panorama im Tiefenraum eines faszinierenden Untergangs gibt ein Pendant zu dem überwältigenden Bild von den toten Achterbahnen auf Coney Island (S....). Die gigantische Anlage ist außer Betrieb, steht aber im gleißenden Licht eines friedvollen Herbsttages, der den Anblick einer stillgelegten Vergnügungsstätte mit dem Hoffnungszeichen eines Regenbogens überwölbt. Das Bild knistert und funkelt mit Blick auf etwas, das nur geworden zu sein scheint, um zu diesem glanzvollen Sterben zu kommen. Die Sensation der Motive rührt ans Äußerste einer Pathetik des Fassungslosen. Aber sie wird gebändigt von dem Schrecken, den auch die Schönheit auslösen kann. Diese Balance zwischen extremen Gefühlsausschlägen zu suchen, hat Rauch auch dann nicht aufgegeben, wenn er als Fotograf die Abschiedskulissen seines eigenen Bürgerlebens betrat: Das untergegangene „Neue Deutschland“ steht über der Nacht vollkommener Menschenleere (S....). Alle sind weg, abhandengekommen, woanders unterwegs. Nur die Schneeflocken kümmert es nicht. Sie durchrieseln den Schrecken mit sanfter Poesie. Es ist der Abend vor seiner Ausreise in den Westen.
7.
Alle diese Bilder haben sich einer Regung zu verdanken, die nicht die des Betrachters sein muss, ihn aber doch nicht einfach in das gefällige Einvernehmen mit einem Schnappschuss entlässt. Selbst dann, wenn sich wie beim Mauerfall Weltgeschichte ereignet, überschreiten Rauchs Bilder die Grenze der Ereigniskolportage, indem sie das Motiv in Kontraste kristallisieren und streng komponierte Blickverläufe organisieren. So wird im Ansturm auf den Westen ein Grenzoffizier von Menschen umspült wie von den erhitzten Hoffnungen eines delirösen Alptraums (S....). Das Flimmern unscharfer Bewegungsabläufe auf der Fläche, die das Bild einer strudelnden Leuteerregung zeigen, läuft auf diesen einen Wachmann zu, der in das Zentrum des Geschehens will. Seine helle Stirn zeigt die einzige Stelle im Bild, die scharf, im entscheidenden Augenblick eines Weltbruchs also unbewegt geblieben war. Die Fotografie von einem Initiationsritus in Marakesch kommt von einem anderen Kontinent und als fotografierbares Geschehen aus einer anderen Epoche (S....). Der Zusammenhang mit dem Bild vom Mauerfall ergibt sich allein aus der Sicht des Fotografen, der auch hier das chaotische, unberechenbare Gewirr aufgeregter Menschen im Punkt eines einzigen Akteurs fokussiert. Es ist die Figur von Vater und Sohn auf dem hochragenden Schimmel. Sie scheinen auf der Augenlinie des Betrachters zu schweben, während sie eine Schneise des Lichts vor sich herschieben und das Gewitter von Hell und Dunkel wie auf einer Partitur ordnen. Die Präzision der Bildchoreografie entwickelt in beiden Fällen eine innere Erzählung, die über die äußere, also motivgebende hinausweist.
In solchen durchgezeichneten Bildern scheint die Welt auf, aber als das Fragment einer Selbstwahrnehmung des Fotografen, der im Unterwegssein die Spuren seiner Lebensreise gleichsam erschafft. Zugleich ist er Chronist von Geschehnissen, die unbetrachtbar geblieben wären, wenn sie nicht auf die Höhe eines Bildereignisses zu heben gewesen wären. So gilt die Aufmerksamkeit der Bilder nicht einfach dem Übersehenen, dem sich ein sorgendes Auge zu widmen hätte, weil es sonst niemand tut. Vielmehr suchen sie im Moment das Ereignis der Zeit, um ihr ein Antlitz zu geben.
8.
Mit „Antlitz“ ist zugleich der zentrale Begriff im Schaffen Ludwig Rauchs angesprochen. Es geht ihm um das Antlitz der Gegend, in der er sich bewegt, um das Antlitz von Dingen, die darin hervortreten und um das Antlitz von Menschen, die ihm bei all dem begegnen. Seine Bildnisse füllen ein ganzes Archiv. Es gibt abgeschlossene Serien und es gibt milieugebundene Langzeitprojekte wie die Porträts aus dem internationalen Kunstbetrieb. Der Reiz aller dieser Bilder aber ist, dass sie den Kernbegriff des Genres, die Repräsentation, auf eine bezeichnende Weise verfehlen. Die Schimäre des „Abbildes“, der Ähnlichkeit, der Demonstration, der von sich selbst umrissenen Erinnerungsfigur, wird aufgelöst, indem der Fotograf sein Gegenüber stets selbst agieren lässt und ihn dabei auf den Punkt zutreibt, an dem das Bild seine komplexeste Aussagedichte erhält. Der Darstellungsraum des Porträts ist dann immer ein Bewegungsraum für Einzelheiten, Zuweisungssignale und Attribute, die mit der Person die Aura einer zugehörigen Umgebung oder einer auf sich zurückzeigenden Geste schaffen.
So funktioniert das Porträt Heiner Müllers (S....), der neben der Brecht-Skulptur von Fritz Cremer posiert, zunächst über den Zusammenhang des einen Dichters zum anderen. Die Skulptur des toten Vorgängers hält aber der lebendigen Figur des Nachfolgers nicht stand. Müller bestreitet durch seine Anwesenheit das Denkmal, indem er zeigt: Ich lebe. Das heißt dann: Nur ich bin da. Müller verdeutlicht mit seiner abwehrenden Geste, dass er weder eine Bronze noch das Foto als sein Denkmal will. Er verlacht die Kunst und weist mit der ungleichen Nachbarschaft zu dem anderen auf die Differenz seiner mit der Vorgängerposition.
9.
Nicht zuletzt darin zeigt sich, dass es Ludwig Rauch immer noch um jenen „fruchtbaren Augenblick“ geht, den Lessing an einer antiken Skulptur namhaft gemacht und zur Wurzel der bildenden Kunst erklärt hat.(2) Für die Anreicherung weiträumigster Zusammenhänge, für das Erwirken einer Konstellation von unüberbietbarer Absättigung, ist das Bildnis als Fach auf eine besondere Weise prädestiniert, weil es im Bruchteil eines Geschehens realisiert werden muss, ganz gleich, ob der Fotograf Zeit hat, seinen Protagonisten aufzustellen oder von ihm aufgestellt wird.
Ein Beispiel für Letzteres gibt das Porträt Ernst Jüngers (S....). Der Fotografierte weiß nicht, dass Ort, Zeit, Raum und Ambiente das Bild von ihm zu einem Porträt verdichten konnten. Der Schriftsteller, konservative Instanz einer Epoche, steht in einer Installation von Christian Boltanski, die auf der Biennale in Venedig 1993 als Archiv aufgebaut wurde. Die Bilder, zu Material verfremdet, gelten den kulturellen Kontexten des Holocaust. Der Autor, den seine Tagebuch-Erzählung „In Stahlgewittern“ 70 Jahre zuvor berühmt gemacht hatte und an dessen Namen alle Zweifel über die Rolle der deutschen Eliten haften, steht mit der Lupe vor Abbildungen, die er kennen dürfte. Vergegenwärtigen bekommt bei diesem Porträt, das einen fragilen, aufmerksamen, aber nicht unschuldigen Greis zeigt, einen Tiefenschmerz. Empfindsamer kann ein Porträt Ernst Jüngers kaum werden: Er agiert im Kontext der Kunst als der Betrachter, dessen Perspektive er auch in seinem Schreibgestus einnimmt, wenn er zu den Schrecken der Zeit sozusagen: Stellung bezieht.
Das Gegenstück zu solchen Porträts, die sich der Wachheit verdanken, sind die Freundschaftsbilder (S. xx bis xx), die sich einer Idee stellen. Jemand soll über sich aussagen, indem er oder sie seinen besten Freund oder seine beste Freundin ins Bild holt. Die „Freunde“ greifen auf einen Topos der Romantik zurück und transferieren ihn in die Gegenwart für die Inszenierung einer Selbstreflexion. An der Serie arbeitet Rauch konzeptionell seit etwa fünf Jahren. 2010 wurde Ausschnitte daraus mit den dazugehörigen Kommentaren im „stern“ veröffentlicht. Die Gesten und Konstellationen sind den Porträtierten überlassen, die Abgründe der Entscheidung aber auch. Es geht um die Gestaltwerdung einer geistigen Konzeption von Verbundenheit, die zu definieren für den Befragten mindestens so kompliziert, ja problematisch ist, wie die Festlegung, mit wem, außer sich selbst, er das Thema personifizieren will. Im Auftreten der „Freunde“ porträtiert sich so auch ein Zwiespalt, der nicht nur in die Frage nach dem Warum der Wahl mündet, sondern den Betrachter auch nach der Glaubwürdigkeit der zweisamen Bejahung fahnden lässt. Die Porträts beunruhigen zutiefst, weil sie gerade als Manifestationen der Entscheidung eine Unsicherheit postulieren, die dieses eine Mal, im Bild, überwunden scheint. So sind diese Doppelporträts immer auch Einzelporträts, je nachdem, an welchem Punkt der Betrachtung man innehält. Sie wenden das Genre ins grundsätzlich Existenzielle, indem sie die Differenz zwischen Vorstellung und Vorstellen auf das dünne Eis eines Bekenntnisses stellen.
Das Problematische zwischen Lebensentwurf, Lebensführung und Lebensbild wird so als das eigentliche Thema des Porträtierens umrissen. Darin unterscheidet sich die zuletzt entstandene, forciert konfrontative Freunde-Serie nicht von der ersten, die Ludwig Rauch in der Zeit anlegte, in der auch das Brigadebild entstand: Die Rentnerbilder von 1986 (S. xx bis xx)zeigen Passanten auf der Schönhauser Allee, die sich porträtieren und zugleich fragen ließen, welchem Beruf sie in ihrem Leben nachgegangen seien. Die Bilder entbergen die Magie ganzer Erzählungen, weil sie auf die Frage zudrängen, ob man im Bild, das die Leute abgeben, das Bild wiederfindet, das man von ihnen erwartet. Die Unschuld der reinen Ansichtigkeit nimmt fast den Schmerz einer Entblößung an, der sich die so Betrachtbaren doch ohne Scheu aussetzen. Das Porträt findet durch diese Preisgabe aus dem Zufälligen heraus und berührt zutiefst, weil es die Frage nach der Vergeblichkeit unserer Wünsche mit der Eigenmacht einer Selbstbehauptung konfrontiert.
10.
Sieht man das alles zusammen, ist unschwer zu erkennen, dass sich Rauchs Auffassung von der Fotografie um die Steilheit avancierter Positionen nicht weiter schert. Vieles, was er bewundert, käme für seine eigene Arbeit nicht infrage. Und vieles, was für andere allein infrage kommt, bewundert er nicht. Der Glanz und die Kälte einer Sachfotografie, wie sie seit Ausgang der 1980er Jahren in der Neuen Düsseldorfer Schule aufkam, bewegen sich in einer eigenen Tradition, von der Rauch so wenig berührt wurde wie von allen Formen spektakulärer Selbstinszenierung oder konzeptuellen Unterwanderungsansätzen. Den Gegenstand seiner Bilder in erratischer Fremdheit zu fixieren oder ihn auf phantastisch manipulierten Oberflächen rätselhaft zu entleeren, wie es Candida Höfer, Thomas Struth oder Thomas Ruff in erschöpfender Konsequenz vollstrecken, läge außerhalb der Reichweite seines Wollens.
Auch der Übergang vom analogen Bild in die digitale Pixelwelt nimmt für ihn eine andere Richtung. Zwar hat sich das Feld der zur Verfügung stehenden Mittel mit den abstrakten Zahlen hinter den Bildpunkten unendlich erweitert. Mit seinen Voraussetzungen verlagert sich aber auch die Bedeutung des sichtbar Gemachten: Das digitale Bild hat außer in sich keinen Ursprung und keinen Endpunkt mehr. Es verliert das Motiv, wenn es, wie bei den prächtigen Großpanoramen von Andreas Gursky, nur noch auf definierten Zeichen beruht. Die Autorität des Gestaltungswillens ist totalisiert, um die Autorität seines Gegenstandes absichtsvoll zu negieren, mit ihm aber auch die Qualität dessen, was beim Auslösen ehedem als analoger Eigenwert standhalten musste. So verbürgt das digitale Foto seine tendenzielle Selbstaufhebung als Fotografie. Die glückliche Konstellation, die Güte des Augenblicks, der Moment als innigster Einspruch gegen die Vergänglichkeit haben keinen Sinn mehr, wenn sie die Bildwürdigkeit verlieren. Der Fotograf als Pixelmaler hört auf, Fotograf zu sein.
11.
Diese fundamentalen Abwendung vom Quellpunkt des Mediums ist eine Konsequenz, die Ludwig Rauch zwar akzeptiert, aber nicht mitträgt. Auch wenn heute die technischen Mittel dafür zur Verfügung stehen, sieht er es nicht als seine Aufgabe an, sein autonomes Künstler-Ich dem Missverständnis jenes unbelehrbaren Betrachters entgegenzuhalten, der in der Fotografie immer noch die Verdoppelung der Realität sieht. Dass Fotografie die Vorkommnisse der Außenwelt spiegle und darin authentisch sei, ist Irrtum des Mediums von Anfang an. Authentisch war und ist nie das Bild, sondern immer nur der Fotograf, dessen Bild wiederum nie etwas anderes würde als ein Bild. Die apparatehafte Herstellung der Fotografie mit Linsen, Blenden und Verschlussmechanik änderte nichts daran, dass man zuletzt doch immer nur Abzüge herausbekam, deren Anlass man schon selbst hatte herbeiführen müssen. Das Wirklichkeitsversprechen eines fotografierten Motivs hat seinen tiefsten Sinn ja nicht darin, etwas Vorhandenes tatsächlich abzulichten, sondern auf der Bildfläche klar zu stellen, dass sich dieses Vorhandene einer Verabredung mit ihm verdankt. Das Bildmotiv zeigt immer die Reaktion von jemand, der etwas sah. Was er sah und wie die Reaktion darauf ausfiel, sind die zwei Pole, zwischen denen der Betrachter seine Betrachtung einrichtet. Fällt das auf diese Weise realisierte Sehen weg, fehlt dem Spiel mit den Illusionen des Bildes der Referenzpunkt der Phantasie. Genau um diesen Punkt der Beteiligung, also um das Zulassen von Emotionalität, geht es Ludwig Rauch. So fotografiert er zwar auch mit Digital-Kameras, aber sie bleiben für ihn, wie seine Leica, Instrumente zur Erschaffung von Bildwelten, für die er die Begegnungsverhältnisse bereits geklärt hatte, lange bevor von Pixeln auch nur die Rede war.
12.
An den dreifach zusammengesetzten Strukturbildern kann man das sehen (S. xx bis xx). Machtvolle Einzelbilder befragen innerhalb eines gesetzten Rahmens die Zusammenhänge eines Lebenswerks. Jedes der Fotos ist verschiedenen Serien, Arbeitszusammenhängen und Auftragshintergründen entnommen. Aber es vergesellschaftet sich hier ohne den intentionalen Ausgangspunkt eines planvollen Entstehungsgrundes, der den neuen Konstellationen gemeinsam wäre. Die Zusammensetzung erfolgt retrospektiv aus dem vorhandenen Material und gerinnt zu einem neuen Bild, das seinen eigenen Gestaltungsregeln folgt. Es entstehen Bildstreifen, deren Facetten durch formale, also vom Motiv emanzipierte Gesichtspunkte zusammengehalten werden. Das Einzelbild wird in die Parzelle einer Gesamtkomposition verwandelt, zugleich aber in der Nachbarschaft anderer Bilder aufgehoben. Ein Lichtkasten setzt den Rahmen und ermöglicht die ungeheure Strahlkraft eines transparenten Bildkörpers.
Das ist brillant. Aber was geschieht hier? Gerade das zutiefst Faszinierende an den Bildkonglomeraten macht die Frage nach dem Sinn von Bildern im Grundsatz evident. Die eigenen Fotos zu Fragmenten eines anderen Zusammenhangs zu machen, heißt nichts anderes, als das, was sie als Foto ästhetisierten, noch einmal zu ästhetisieren, also von sich selbst zu entfremden. Zugleich aber wird ihnen durch diese Enteignung von Anlässen ein Überleben gesichert, das sie sonst vielleicht gar nicht mehr hätten. Deshalb können diese „Triaden“ auch als leuchtende Altäre angesehen werden, die auf ihre säkulare, das heißt technische Weise das Ende einer Konfession symbolisieren. Mit ihnen wird das Denken der analogen Bildwelt noch einmal gefeiert, ohne über die Bilderflut, den Pixelwahn oder die Fragwürdigkeit des Kunstbetriebes zu klagen. Ludwig Rauch öffnet in diesen jüngsten Arbeiten sein gesamtes Werk und hebt es in ein Licht, das alle Gründe für die Entstehung und die Existenz seiner Bilder überblendet: Sie feiern sich selbst – in wechselnden Konstellationen.
Michael Freitag
Anmerkungen:
(1) Boris von Brauchitsch: Kleine Geschichte der Fotografie. Stuttgart 2012, 10
(2) Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie (1776). Stuttgart 1994
seit 1992
Mehr...seit 1992
Mehr...