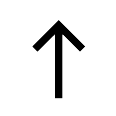Michael Freitag, Halle/Saale
Eröffnungsrede vom 21.01.2009 zur Ausstellung "Hunting Grounds" von Ludwig Rauch
Meine Damen und Herren, wissen Sie was eine Blume ist? Eine Blume ist ein Hasenschwanz. Teller sind die Ohren des Schwarzwildes. Eine Drossel ist die Kehle des Tieres und ein Mönch ist ein geweihloser Hirsch. Die Jägersprache ist eine überaus zutreffende Poesie. Das ist wohl früher schon bemerkt worden. Denn ein Jagdschein bedeutet für viele heute noch, dass jemand auf attestierte Weise nicht ganz richtig ist. Nicht richtig ist jemand, der zum Beispiel weiß, dass der unterschiedliche Gebrauch ein und desselben Begriffes auf die gleiche Bedeutung hinauslaufen kann. Man denke nur an das Wort „Losung“. Das bedeutet bei Jägern das Exkrement der Tiere, konnte vor 30 Jahren aber auch heißen: „Mit der allseitigen Erfüllung der Aufgaben im Jagdwesen leisten die Jäger ihren Beitrag bei der erfolgreichen Durchführung der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED.“ Losung oder Losung! Das ist hier nicht die Frage, sondern das ideale Zusammenfallen von Wort und Sinn. Die eine Ausscheidung bekommt mit der anderen jene narrenhafte Einsinnigkeit, die wir auch Wahrheit nennen. Sie ahnen es: Als ich diese Eröffnung zusagte, wusste ich nicht, worauf ich mich einließ. Es zeigte sich bald: Das Thema Jagd ist unerschöpflich und für einen Stadtmenschen wie mich von bestürzender Abgründigkeit. Was weiß man denn schon. Wissen konnte ich, dass Jagen eine Urtechnik der Nahrungsbeschaffung ist. Wissen konnte ich, dass der Wald einmal ein mythischer Ort war, wo Legenden und Märchen zwischen Tann und Weiher hausten. Das ist freilich lange her, lange bevor der Wald als Freizeitrevier panisch durchquert wurde von schnaufenden Menschen, die ihr Gejagtsein als Jogging bezeichnen. Man erinnert sich auch an Förster Grünrock, an Flinte und Hund. Und doch empfindet man bei aller Romantik ein leichtes Unbehagen bei dem Gedanken, dass die Geweihe in einem hübschen Jagdschloss ja einmal von den Tieren irgendwie – abgemacht worden sein müssen. Das Thema „Hochsitz“ ist noch viel irritierender. An ihm finden sogar Verbrechen statt. Die Posten werden immer wieder von Sabotageakten heimgesucht. Es gibt wegen angesägter Stützen oder Leitern oft schwere Unfälle. Die ZEIT berichtete vor ein paar Jahren schon von einem „Halali auf die Jäger“. Tierrechtler werden zu Menschenjägern. Das Jagen als Morden wird dabei von dem Argument gestützt, aus der Deckung zu schießen sei feige. Heimliches Ansägen ist es wohl nicht, woran man sehen kann: Der Mensch selbst ist ein unberechenbares und darum gefährliches Tier. Ein gefährdetes auch, wenn man liest, dass ein Jäger mit seinem Enkel hier in der Nähe, bei Vogelsang, fluchtartig „abbaumen“ musste, weil beide wegen einer defekten Hochsitzheizung beinahe in Flammen aufgegangen wären. Und auch die soziale Wirklichkeit mit ihrer eigenen Rauheit dringt in das Dunkel der Forste. So berichtete BILD von einem Arbeitslosen, der tot vor einem Jahr auf einem Hochsitz gefunden wurde, weil er beschlossen hatte, da oben zu verhungern. „Hunting Grounds“, Jagdgründe – der Titel dieser Ausstellung umfasst nicht nur die Gründe der Jagd. Man bekommt es, mit Kriminalistik, Sozialfürsorge, Brandschutz und anderem zu tun. Erstaunlicher als das ist es aber, dass in den Fotografien derlei nicht vorkommt. Nirgendwo das Grauen, nirgendwo die böse Hand, keinerlei Gewalt. Die Fotos zeigen erst einmal nichts als Hochsitze. Dieses Kahlhalten des Motivs allerdings ist überaus bedeutungsvoll, nicht nur im Zusammenhang mit dem Thema, sondern auch im Zusammenhang mit der Kunst. Schon viele Fotografen haben Hochsitze abgelichtet, weil ihnen eine hohe Symbolträchtigkeit zu eignen scheint. Trotzdem unterscheiden sich die Bildanlässe erheblich. So hat ein Fotograf Hochsitze beispielsweise aus der Perspektive fotografiert, aus der die Tiere sie ansehen würden. Er wollte zeigen wie es dem Wild ergeht, das im nächsten Moment zu Tode kommen kann, weil es vielleicht nicht ahnt, dass hinter dem kuriosen Verschlag der Fangschuss lauert. Mit der Blickrichtung der Bilder soll das Mitleid des Betrachters angewärmt werden. Übersehen wird, dass durch das scheinkritische Konzept die Tierseele mit Schicksalsgedanken und Todesfurcht versehen wird, mit Menschengefühlen also, über die ein Wildschwein sich wohl wundern würde. Ewige Themen, Geburt und Tod, Mensch und Natur werden einem ebenso ungefähren wie modischen Gesichtspunkt unterworfen, wobei der Jäger als Funktionär der Mordlust zum Waldrambo herunterkommt. Der Hochsitz wird dann zum Denkmal eines Hinrichtungswillens. Das Unangenehme an dieser Zuspitzung ist, dass der bösen Kehrseite die gute Front fehlt – das wäre der Sinn des Hegens. Wildfraß, Überpopulation und ökologisches Gleichgewicht werden einem moralischen Kalkül geopfert. Der Natur wird dabei nicht weniger Gewalt angetan, als jener verachteten Bewirtschaftungskultur, der ein Fotograf sein gut genährtes Publikum verdankt. Nun, ich erzähle das alles, weil Ludwig Rauch seine Arbeit ganz anders versteht. Ihn lockten allein die Brandenburger Forste und Steppen. Und er reagierte beim Wandern nur darauf, was er in der Einfalt seines Soseins antraf. So stieß er auf eine unfassbar vielgestaltige Jagdgerätschaft. Sie punktiert das Landschaftsbild auf seltsame Weise und erfreut an den unverhofftesten Orten den ziellos schweifenden Blick. Auf seinen Bildern führen diese Hochsitze das Dasein jener verzaubernden Sinnlosigkeit, die man auch Kunst nennt, weil sie allein gerechtfertigt sind durch den Blick, der sie zum Ereignis macht. Wahrnehmen ist Gestalten und Gestalten ist Wahrnehmung herstellen. Man versteht plötzlich, dass diese abenteuerlichen Stelzkisten an raffiniert ausgesuchten Orten stehen, dort, wo Licht, Schatten und Mond das Spiel zwischen Sicht und Verborgenheit am besten zulassen, weshalb sie auch unendlich langsam vor sich hin rotten dürfen. Betritt man sie in aller Behutsamkeit, öffnen sie weite Blicke ins Revier, wo ein Wild sein Futter sucht und sich rein gar nichts dabei denkt. Der Fotograf findet, wie der Jäger, die richtige Stelle, um vor dem Motiv zu seinem Bild zu kommen, und sonst? Sonst ist es ringsherum nur wunderschön. Ich fragte mich, was jemand dort oben eigentlich macht, wenn es finster wird. Und dann drang eine heiterfriedliche Vorstellung in mich ein: Überall dieses geräuschvolle Schweigen aus Knacken und Stille mit funkelndem Tau unter Nebelschwaden – das muss bewegend sein. Ein Mensch sitzt da in seinem Verhau und schweigt. Er hat sicher ganz anderes im Sinn als Aas und Sterbelaut. Vielleicht, denke ich, denkt der Jäger so wenig wie das Tier, wenn er hier draußen ist. Er gerät in den vegetativen Zustand jener zellularen Unbefragtheit, die er mit den Kreaturen teilt, und die ihm und seiner Alltagsgeschundenheit so gut tut, weil sie außerhalb des Waldes kaum zu erreichen ist. Er will die Einsamkeit und den Abstand zu seinem lärmenden oder lähmenden Zuhause, zu Pflicht und Gehorsam, zu Disziplin und Gelderwerb – und darum sitzt er hier. Wo, fragte ich mich mit sanftem Neid, wo findet man heute noch eine Stelle wie diese, einen Hochsitz, der einen nicht nur vor Tieren, sondern auch vor Menschen verbirgt, vor Nachbarn, Kollegen, Tanten und Tierpsychologen. Wo kann man noch wortlos einen Schnaps oder einen Kaffee trinken und mit dem Atem dampfen, ohne dass einem einer über die Piste rennt. Wo kann man noch schweigen in der ganzen Monumentalität dieses Begriffs. Auf dem Hochsitz, verstand ich, kann man es. Man ist im Freien und so gesehen – wirklich draußen. Und dann war ich sicher: Eine Flinte vielleicht nicht, aber einen Hochsitz hätte ich ganz gern. Und da ist noch etwas. Wenn man die Fotografien durchgeht, wird man nicht fertig mit dem Staunen darüber, was die menschliche Kreativität alles möglich macht. Diese hochhüftigen Mut-Konstruktionen stellen eine Sozialgeschichte des menschlichen Improvisationsvermögens dar, wie sie überraschender kaum sein kann: Hier gipfelt eine verrückte Laube über einem pyramidal zusammengehämmerten Stützensystem, dort hat sich einer so etwas wie einen Waldbarhocker mit Armlehne hingestellt, wieder ein anderer montiert seine Blechhütte auf eine Hängerlafette, die noch aus LPG-Zeiten stammt. Der eine arbeitet korrekt, lotrecht und solide, dem anderen sinkt das Ding aus innerer Schwäche seitlich ins Gebüsch. Manche dieser Hochsitze haben eine so kühne formale Schönheit, dass sie als jene kubistischen Skulpturen durchgehen könnten, die es in der Kunstgeschichte nicht gibt. Es gibt sie in keinem Museum, meine Damen und Herren, aber im Wald!!, da stehen sie rum. Vor allem das auf drei Metallbeinen balancierende und mit Drahtseilen verspannte Ding ist von so abgedrehter Schönheit, dass mir kein Natursymposium einfällt, wo ein Bildhauer ein ähnlich radikales Landschaftszeichen aufgerichtet hätte. Dieser Hochsitz ist eine Skulptur, die als ästhetische Selbstbehauptung die Funktion vergessen macht, der sie sich letztlich verdankt. Und ich begreife plötzlich, dass dieser Effekt einer Fremdheit geschuldet ist, die sich nicht zuletzt dadurch einstellt, dass die Ansitze und Hochstände am hellerlichten Tag aufgenommen wurden. Im Bild befinden sie sich also außerhalb ihrer eigentlichen Wirklichkeit. Diese stellt sich ja erst im Dämmer oder in der Nacht ein, in jenen Stunden also, in denen die Schweinesonne scheint, wie die Jäger sagen, wenn sie den Mond meinen. Etwas außerhalb der eigentlichen Wirklichkeit sichtbar machen, ist Kunst, wie wir sahen. Und das leisten diese Hochstandfotografien. Sie verarmen das Motiv nicht durch vorgefertigte Aussagen. Sie bereichern es vielmehr um Assoziationen, die über die visuelle erst gedankliche Tiefenschärfe erfahren. Die Reihenfolge ist das Problem. An genau dieser unauffälligen, aber wichtigen Stelle unterscheiden sich Ludwig Rauchs Fotografien von denen anderer, die dem Medium aufbürden, was es nicht leisten kann: Die hier ausgestellten Fotos folgen nicht dem unanschaulichen Ansatz einer ideellen Absicht, der ein Betrachter sich dann unterwerfen muss, sondern sie öffnen den Blick auf etwas, dem das schon Gewusste nichts mehr anhaben kann. Was aber bekommt man zu sehen, wenn man den Fotografien vertraut? Man sieht ein Feld, man sieht einen Waldrand. Das ist umwerfend einfach. Eine nicht unversehrte, aber schöne Gegend sieht man, und der Blick ruht auf etwas, was früher, ohne anzüglich zu sein, Heimat hieß. Diese ruhigen Fotos werden zur Rückblende in eine Gefühlswelt, die seit Wilhelm Buschs Zeiten schon verloren scheint. Wer spricht noch von Mooskissen, Feldrain, oder Firmament, wenn nicht solche Bilder, die ungeheuchelt, aber präzise sind vor der anspruchslosen Würde ihres Gegenstandes? Man sieht in die Fluchten tiefer Landschaftsräume. Sie werden von Himmeln überwölbt und sind von Farben durchtränkt, die in die verborgensten Kammern unserer Seelen leuchten, dorthin, wo wir uns nur manchmal eingestehen, wie sprachlos wir sind angesichts einer sich still ereignenden Natur. Man sieht einen seltsamen Turm in den Glanz eines Abends ragen, erstarrt vom Licht einer bestimmten Zeit. Die Sonne fällt wie ein gleißender Brandsatz durch den Spalt einer Kanzel, die, ein Haufen Holz oder Schrott, im Foto zum Altarbild wird. Überall Freude an dem, was am Wege steht, wenn man einfach nur loszieht und plötzlich aufmerksam wird. Darauf zum Beispiel, dass es im Internet zwar Angebote gibt für Ansitze aus Fertigbauteilen in allen Größen und in jeder Güte, diese aber, sieht man die Fotos an, offenbar keiner will und keiner aufstellt. Und so kann man auch das aus den Fotos schließen: Die Hochsitze sehen aus wie ihre Erbauer. Sie sind Abbild und Selbstausdruck der jeweiligen Persönlichkeit, die hier verweilen will, für sich, für die Tiere und für seine Aufgabe mit ihrer dunklen Seite. Ist es so, dann sind diese Fotografien nicht nur eine Serie zu den unteren Kulturbauten der Menschheit, sondern zugleich auch eine Galerie von Erbauerporträts. Die Fotos haben als Bautenbildnisse eine anthropologische Dimension, auf die man erst stößt, wenn sie gesehen wurden wie hier. An der Individualität der Herrichtung kann man sogar die Handschriften der Baumeister unterscheiden. Achten Sie beim nächsten Mal darauf, meine Damen und Herren. Und – bleiben Sie stets auf der Höhe Ihrer Augen.